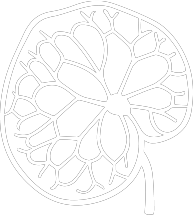Auch wenn der Name Osterluzei an Ostern erinnert, so hat diese Pflanze doch keinerlei Bezug zu dem Feiertag der Christen.
Vielmehr gehört diese Pflanze neben der Haselwurz und der Pfeifenwinde in dieselbe Pflanzenfamilie, die Osterluzeigewächse oder Aristolochiaceae. Sie kommen sowohl als krautige Pflanzen als auch als Lianen vor. Lesen Sie mehr von diesen drei Pflanzen, die schon seit Lehmanns Zeiten in unserem Garten zu finden sind, in unserem Blog.
Die Osterluzei
Die Echte Osterluzei, Aristolochia clematis trägt ihre gelben Blüten zu 2 – 8 Stück in den Achseln ihrer Blätter. Sie ähneln einem Trichter und sind Fliegenkesselfallen. Kleine Fliegen werden von den Blüten angelockt, rutschen in den Trichter und bestäuben auf diese Weise die Pflanze. Die Blütezeit ist von Mai – Juni. Die Blätter sind herzförmig und der Stängel der
Pflanze ist leicht gewunden. Sie wird 20 – 100 cm hoch, stammt ursprünglich aus Südeuropa.
Der griechische Gattungsname Aristolochia setzt sich zusammen aus den Worten aristos für das beste und lockheia für Geburt. Er weist somit auf die Verwendung der Pflanze als Mittel zur Geburtsförderung hin. Die deutsche Bezeichnung der Pflanze ist aus dem griechischen Gattungsnamen entstanden. Der Artname clematitis stammt von dem griechischen Wort klema für Ranke und bezieht sich auf die Wuchsform der Osterluzei.
Die Wurzeln und frischen oberirdischen Teile sind giftig, sie enthalten Aristolochiasäure und Alkaloide. Eine Vergiftung zeigt sich in Erbrechen sowie in Magen- und Darmbeschwerden. Es kommt auch zu Blutdrucksenkung und zur Pulsbeschleunigung. Bei starker Vergiftung kann Atemlähmung zum Tod führen, allerdings sind Vergiftungen kaum zu befürchten und auch nicht bekannt.
Die Pflanze wurde zur Wundbehandlung und auch bei chronischen Geschwüren verwendet. Innerlich verwendete man sie bei Menstruationsbeschwerden, bei Rheuma und Arthritis. Die Osterluzei wurde unter anderem zur Einleitung der Geburt verwendet, galt daher aber auch als Abtreibungsmittel wodurch leicht Vergiftungen möglich waren. Präparate aus Osterluzei sind krebserregend und seit 1981 verboten.

Die Haselwurz
Die Europäische Haselwurz, Asarum europaeum hat eine kriechende Grundachse mit schuppenförmigen Niederblättern und zwei lang gestielten, nierenförmigen, wintergrünen Laubblättern. Meist bildet sich eine kurz gestielte, drüsig behaarte Blüte, die außen grünlich innen rötlich braun und glockenförmig mit drei Zipfeln ist. Die Blütezeit reicht von März bis Mai. Sie kommt in Laubwäldern und Gebüschen Mittel- und Osteuropas bis Zentralasien vor.
Der botanische Name kommt vom griechischen asaron, unverzweigt, der deutsche Name davon, dass sie (angeblich) besonders häufig unter Haselsträuchern wächst.
Laut antiker Autoren wie Dioskurides und Plinius d.Ä. und Kräuterbüchern des Mittelalters nutzte man die Haselwurz als Heilpflanze bei Wassersucht und Ischias, als Brech- und Abführmittel. Das Rhizom läuft offiziell unter Radix asari; es enthält ein ätherisches Öl, das unverkennbar nach Kampfer riecht. Heute wird die Haselwurz von Naturheilkunde und Phytotherapie nicht mehr angewendet, da ihre Inhaltsstoffe, vor allem Asarin und Aristolochinsäure bei hohen Dosierungen zum Tod durch innere Blutungen und Lähmung der Atemmuskulatur führen können. In niedrigen Dosen verursacht der Verzehr der schleimhautreizenden Pflanzenteile ein Brennen in der Mundhöhle, Übelkeit, Erbrechen und Durchfälle. Haselwurz steht im Verdacht, das Risiko von Leberkrebs und Nierenkrebs zu erhöhen. Zudem wirkt sie nierenschädigend (nephrotoxisch). Lediglich in der Homoöpathie macht man daraus eine Urtinktur, mit der sich Asarum-Globuli herstellen lassen. Die Schleimhautreizungen gelten auch für die Gebärmutter; daher wurde das Kraut früher von den Engelmacherinnen auch für Abtreibungen verwendet.
Pferde reagieren besonders empfindlich auf den Verzehr von Haselwurz, sie bekommen davon Übelkeit und Erbrechen.

Die Pfeifenwinde
Die Pfeifenwinde, Aristolochia macrophyllum, auch Großblättrige Pfeifenwinde oder Tabakpfeifenstrauch ist eine Kletterpflanze, stammt aus Nordamerika und kommt ursprünglich in den Bergwäldern von Pennsylvenia bis Georgia und westlich bis Minnesota und Kansas vor.
Die Pfeifenwinde ist ein starkwüchsiger, hochwindender Schlingstrauch. Wenn eine geeignete Kletterhilfe vorhanden ist, kann die Pflanze bis zu zehn Meter hoch und zwei bis sechs Meter breit werden. In den ersten Jahren wächst Aristolochia langsam, danach bis zu zwei Meter pro Jahr. Die glatten, kahlen Triebe sind zunächst auffallend dunkelgrün, im zweiten oder dritten Jahr werden sie graubraun.
Die herzförmigen Blätter der Aristolochia sind wechselständig angeordnet, leuchten in einem satten Sommergrün und werden bis zu 30 Zentimeter lang. Sie fallen erst spät ab und können gelegentlich eine goldgelbe Färbung annehmen.
Die pfeifenartig gebogenen Blüten erscheinen von Juni bis August und werden zwischen drei und acht Zentimeter lang. Die U-förmig gebogene Röhre zeigt sich gelbgrün. Der Saum wird rund 2,5 Zentimeter breit, ist purpurbraun und innen punktiert und gestreift. Um Insekten anzulocken, entwickeln die Kesselfallenblüten der Pfeifenwinde einen an Aas erinnernden Geruch. Die Fruchtstände der Amerikanischen Pfeifenwinde sind keulenförmige, sechsklappige Kapseln. Sie werden sechs bis acht Zentimeter lang, vier bis fünf Zentimeter dick und erscheinen kahl bis flaumhaarig.
Die Pfeifenwinde enthält Alkaloide in Form von Aristolochiasäuren und ist in allen Teilen giftig; der höchste Giftstoffanteil findet sich in den Wurzeln. Sie schädigen die Nieren, verursachen bei Frauen Uterusblutungen und wirken bereits in kleinen Dosen mutagen und damit krebserregend. Daher sollte man auch die in der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) beliebten Aristolochia-Präparate aus asiatischen Pfeifenwinden grundsätzlich meiden.