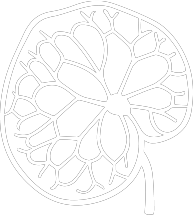Besonders schön anzusehen sind im Moment die Laubblätter des sommergrünen Ginkgo- Baumes, der zudem ein lebendes Fossil darstellt und als Symbol für Langlebigkeit und Widerstandskraft steht. Im Lehmann- Garten befinden sich zwei Ginkgo- Bäume, die uns von Ove Sachse, einem alten Joachimsthaler vor längerer Zeit geschenkt wurden. Neben Ove Sachse gehört auch Christof Bierling als alter Joachimsthaler zu den Menschen, die die Entwicklung von Schule und Gebäudeensemble seit vielen Jahren begleiten und mit ehrlichem Interesse das Wachsen des Lehmann- Gartens zu einem gärtnerischen und botanischen Kleinod verfolgen. So manche Bücher- und Pflanzenspende der beiden bereichert unsere Bibliothek und den Garten. Aus Anlass der Geburtstage der beiden im September haben wir beschlossen, den Baum am Hoftor als „Ove- Sachse- Ginkgo“ und den an der Kellertreppe als „Christof Bierling- Ginkgo“ zu kennzeichnen.




Nicht zu vergessen ist natürlich ein dritter im Bunde der Urgesteine- Wilhelm Gerhardt. Ohne seinen Enthusiasmus, sein Engagement und die akribische und liebevolle Arbeit gäbe es den Lehmann- Garten als gärtnerische, botanische und wissenschaftliche Stätte nicht. Seit der von Wilhelm Gerhardt initiierten Rekultivierung 1988 bemüht er sich unablässig dieses Kleinod für Templin und seine Besucher zu erhalten und zu bereichern. Dafür gebührt ihm unser besonderer Dank und was passt besser zu Wilhelm Gerhardt als das, wahrscheinlich schon aus Lehmanns Zeiten stammende, alte Pfaffenhütchen am Teich. So wird dieses als besondere Ehrung als „Wilhelm Gerhardt- Pfaffenhütchen“ gekennzeichnet. Passend zeigt sich das Pfaffenhütchen jetzt mit seinen bunten Früchten und der farbenfrohen Laubfärbung.


Ginkgo
Der Ginkgo biloba, auch als Fächerblattbaum oder Elefantenohrbaum bezeichnet, gehört zur Familie der Ginkgogewächse. Schon J.W. von Goethe hat 1815 ein Gedicht über diesen Baum verfasst, unter anderem auf der Seite des Goethe Museums Düsseldorf zu finden ist: Gedicht „Ginkgo biloba“
Die Schreibung Ginkgo beruht auf einem orthografischen Fehler, der von Linné 1771 übernommen worden ist, richtiger wäre die Schreibweise Ginkjo, in Japan war der Name Ginkyo gebräuchlich- wobei gin „Silber“ und kyo „Aprikose“ bedeutet. Im Deutschen wird er deshalb als Silberaprikose bezeichnet.
Botanisch ist der sommergrüne Baum interessant, da es dieses lebende Fossil schon vor 250 Mill. Jahren gab. Zu den Nacktsamern gehörend, geben uns die Laubblätter, das Holz, der Befruchtungsmechanismus und die Samen eine Vorstellung von Bau und Lebensweise der Bäume in früheren Stadien der Evolution.
Der Ginkgo ist ein 30- 40m hoher Baum mit anfangs kegelförmiger und später im Alter breiter, gedrungener Krone . Die Laubblätter sind ledrig und frischgrün und werden als Langtrieb- und Kurztriebblätter ausgebildet, zudem sind diese parallelnervig. Die Langtriebblätter sind keilförmig, langgestielt mit unregelmäßigem Rand und haben mittig einen Spalt. Die Kurztriebblätter hingegen sind breit fächerförmig, kurzgestielt . ganzrandig und haben keinen Spalt.

Erst nach 40- 50 Jahren erreicht der Ginkgo- Baum seine Blühreife, die Blüten sind windblütig, eingeschlechtlich und zweihäusig. Der Ginkgo blüht im April/ Mai, im Oktober/ November sind die penetrant riechenden Samen reif und fallen auf die Erde. Der Befruchtungsmechanismus weist ihn als altertümliche Pflanze auf, da dieser sonst nur bei Algen, Moosen und Farnen vorkommt.
Der Ginkgo- Baum hat ein kräftiges Herzwurzelsystem mit tiefen Hauptwurzeln. Er ist in artenreichen Laub- und Nadelmischwäldern zu finden. Seit 1730 kommt er als Parkbaum vor, heute wird er zur Drogengewinnung kultiviert. Seine Heimat ist China und Japan.,
Die Blätter, die Terpene, Ginkgolide und Flavonoide enthalten, werden pharmazeutisch genutzt. Die Extrakte aus den Blättern sollen die geistige Leistungskraft fördern und bei Demenzerkrankungen wie Alzheimer helfen. Zudem werden dies auch bei depressiven Verstimmungen, bei gefäßbedingtem Schwindel und Ohrgeräuschen eingesetzt.

Pfaffenhütchen
Das Europäische Pfaffenhütchen, lateinisch Euonymus europaeus, gehört in die Familie der Spindelbaumgewächse. Im Kräuterbuch von Marcell tauchen auch folgende Namen auf: Mangelbaum, Pfaffenkäppchen, Spillbaum oder Zweckholz. Dieser heimische Strauch wird 3- 4m hoch und hat ein flach wachsendes filziges Wurzelwerk, das zahlreiche Ausläufer austreibt, sodass lichte Standorte schnell zuwachsen. In der Natur findet man Pfaffenhütchen in lichten Laubwäldern, im Auwald, an Waldrändern sowie als Teil von Trockengebüschen. Unser Pfaffenhütchen ist ein typischer Europäer, dessen Verbreitung von Nordspanien bis an die Wolga reicht. Das gelbe Holz gilt als sehr zäh, weshalb man früher daraus Orgelpfeifen, Schuhnägel, Stricknadeln und Spindeln gefertigt hat. Der Name Pfaffenhütchen geht auf die leuchtend rosa bis rot gefärbten Früchte zurück, die wie ein Birett katholischer Geistlicher aussehen.
Die unscheinbar gelblich- weißen Blüten sind im Mai/ Juni zu sehen, ab August reifen die Früchte aus. Nach dem Aufspringen der vier Fruchtklappen werden die an Fäden hängenden, orangerot ummantelten Samen freigegeben. Die nektarreichen Blüten werden von Insekten bestäubt, die Samen stehen bei Vögeln hoch im Kurs und werden auf diese Art und Weise verbreitet. Der Name „Rotkehlchen- brot“ verweist auf eine der Vogelarten.

Alle Pflanzenteile, besonders die Samen enthalten Giftstoffe wie herzwirksame Glykoside und verschiedene Alkaloide. Große Weidetiere können daran sterben. Auch für den Menschen ist diese Pflanze gefährlich, der Genuss der Früchte kann zu Kreislaufstörungen, Koliken und Fieber führen. Erst nach wenigstens 12 Stunden tritt die Giftwirkung ein, im Extremfall kann es beim Verzehr von 30- 40 Samen zu tödlichen Lähmungen kommen.
Das Pfaffenhütchen hatte schon im Altertum alles andere als einen guten Ruf, obwohl der wissenschaftliche Name Euonymus so viel wie „von gutem Ruf“ bedeutet. Die Giftigkeit des Strauches war den antiken Griechen wohl bekannt, Theophrastus meinte sogar die Blüten würden „nach Mord riechen.“ Man wollte böse Dämonen, die man hinter der Giftwirkung vermutete, mit der scheinbar harmlosen Benennung austricksen.
Text: Cornelia Hinz, Karola Ulrich und Cordula Lick
Fotos: Gabriel Dobersch